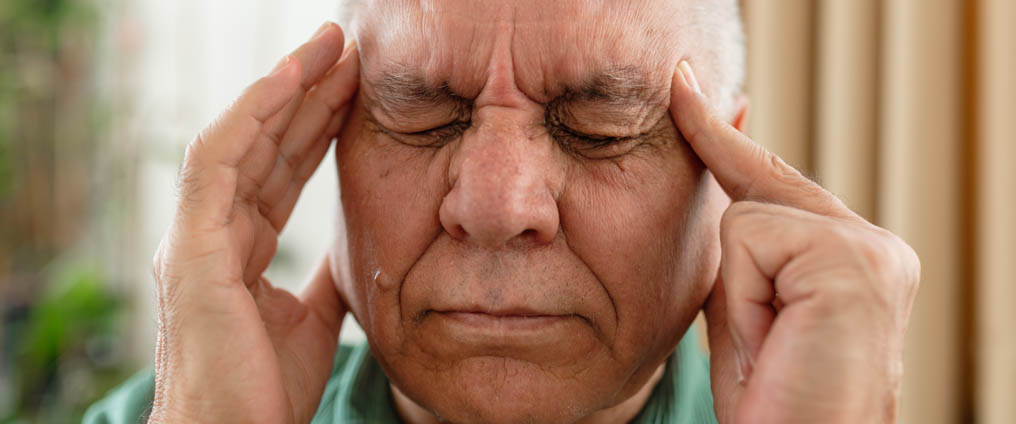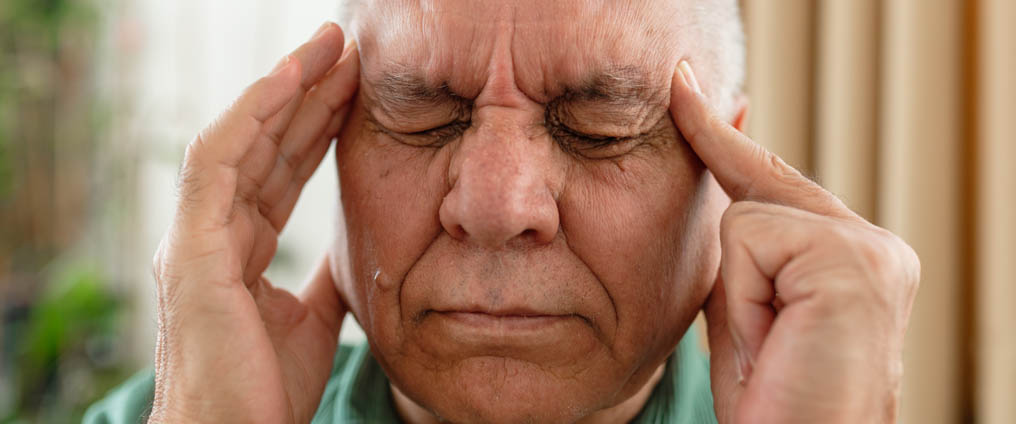Lungenembolie - Symptome, Ursachen und Behandlung

Schnelleinstieg in unsere Themen
Eine Lungenembolie zeichnet sich meist durch ein oder mehrere, durch Blutgerinnsel, verstopfte Gefäße aus. Die Gerinnsel stammen häufig aus der Bein– oder Beckenvene und führen zu einer geringen Durchblutung der Lunge. Bemerkbar macht sich die Lungenembolie durch eine spontan einsetzende Luftnot, Schmerzen beim Atmen sowie Herzrasen oder plötzliche Bewusstlosigkeit.
Da die Lungenembolie auch zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand führen kann, sollte jeder Verdacht umgehend notärztlich abgeklärt und behandelt werden. Bei frühzeitiger Diagnose setzt der Arzt oder die Ärztin eine medikamentöse oder operative Behandlung ein, die das verschlossene Gefäß wieder öffnet.
Was ist eine Lungenembolie?
Die Lungenembolie stellt die dritthäufigste Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems dar. Bei dieser Erkrankung ist meist ein Blutgefäß der Lunge durch ein Blutgerinnsel, auch Thrombus genannt, verstopft. In über 90 Prozent aller Fälle stammt der Thrombus aus der Bein- oder Beckenvene und wird mit dem Blutstrom in die Lungenarterie eingeschwemmt. Dadurch wird die Lunge nicht mehr ausreichend durchblutet: In der Folge atmet der betroffene Mensch möglicherweise tiefer und schneller (Hyperventilation). Da eine Lungenembolie das Herz stark belasten kann, ist ein Kreislaufzusammenbruch möglich. Vor allem das Risiko eine Lungenembolie zu übersehen ist hoch: Bei über 30 % aller Fälle erfolgt die Diagnose erst nach dem Tod – dieser kann innerhalb weniger Stunden nach Symptombeginn eintreten.
Was sind Symptome einer Lungenembolie?
Blutgerinnsel in den Beinen bleiben in 50 Prozent der Fälle unentdeckt, da sie ohne erkennbare Symptome (asymptomatisch) sind. Gelangt der Thrombus allerdings durch die Blutbahn in die Lunge, können je nach Größe des Gerinnsels plötzlich Symptome auftreten, die allerdings nicht immer eindeutig zuzuordnen sind und oft mit einem Herzinfarkt verwechselt werden.

Anzeichen für eine Lungenembolie können sein:
- Erschwerte Atmung bis hin zur Luftnot
- Husten mit teilweise blutig gefärbtem Schleim
- Herzrhythmusstörungen mit erhöhter Herzfrequenz
- Beschleunigte Atmung
- Kalter Schweiß
- Fieber
- Atemabhängiger Schmerz im Brustkorb
- Bläuliche Verfärbung der Lippen
- Plötzlich eintretende kurzzeitige Bewusstlosigkeit
- Schock bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand
Betrifft die Lungenembolie ein kleines Gefäß in der Lunge, treten oftmals nur leichte Beschwerden wie Luftnot und Schmerzen beim Atmen sowie Schwindelgefühl auf. Verschließt das Gerinnsel hingegen eine Haupt-Blutbahn der Lunge, kann dies lebensbedrohlich sein. Durch den Verschluss wird die Lunge in ihrer natürlichen Funktion, Sauerstoff aufzunehmen und Kohlenstoffdioxid abzugeben, eingeschränkt. In das Blut gelangt dann nur noch eine unzureichende Menge an Sauerstoff, was die Atemwege stark verkrampfen lässt sowie möglicherweise einen Schock in Form eines Kreislaufzusammenbruchs zur Folge hat.
Wie entsteht eine Lungenembolie?
Eine Lungenembolie entsteht oftmals durch ein aus dem Bein stammendes Blutgerinnsel, das durch die Blutbahn in die Lungenarterie gelangt. Dabei gibt es drei Faktoren, die auch als Virchow-Trias bezeichnet werden und die Entstehung des Thrombus begünstigen:
- zu langsamer Blutfluss
- Verletzung oder Veränderung der Innenwand des Blutgefäßes
- erhöhte Gerinnungsneigung des Blutes
Eine erhöhte Gefahr, Blutgerinnsel zu bilden, besteht für Menschen, die bestimmte Krebsmedikamente einnehmen, die die Gerinnungsneigung des Blutes beeinflussen.
Auch während einer Schwangerschaft liegt ein 4-Fach erhöhtes Risiko einer Thrombus-Bildung vor. Daher besitzen Schwangere auch ein höheres Lungenembolie-Risiko.
Weitere Risikofaktoren, die die Entstehung einer Lungenembolie begünstigen, sind beispielsweise:
- Bewegungseinschränkungen (Bettlägerigkeit, lange Flugreisen)
- Hohes Lebensalter
- Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
- Starkes Übergewicht
- Rauchen
- Einnahme der Anti-Babypille
- Störung der Blutgerinnung
- Einige Herz- und Lungenerkrankungen
In manchen Fällen stecken als Ursache hinter der Lungenembolie auch Fetttröpfchen oder kleine Partikel des Unterhautfettgewebes. Nach operativen Eingriffen oder durch Knochenbrüche ist es möglich, dass diese fettigen körpereigenen Substanzen in die Blutgefäße gelangen und zu einer Verstopfung führen. Diese sogenannte Fettembolie kommt jedoch nur in sehr seltenen Fällen vor.
Eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann das Risiko erhöhen, dass sich Blutgerinnsel in den Venen bilden, die dann auch in die Lunge wandern und eine Lungenembolie auslösen können. Besonders bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, ist dieses Risiko höher. Bei Menschen, die auf der Intensivstation liegen, bekommen bis zu 14 von 100 eine solche Blutgerinnung, bei anderen Patienten im Krankenhaus sind es etwa 7 bis 8 von 100. Dieses erhöhte Risiko kann auch noch Wochen nach der Infektion bestehen bleiben.
Wie wird eine Lungenembolie diagnostiziert?
Jeder Verdacht auf eine akute Lungenembolie sollte sofort von einem Arzt oder einer Ärztin abgeklärt werden. Dabei setzt der Arzt oder die Ärztin unter Berücksichtigung von Symptomen und Risikofaktoren verschiedene Methoden ein.
Zunächst führt der behandelnde Arzt oder Ärztin eine Befragung zum Krankheitsverlauf (Anamnese) und verschiedene körperliche Untersuchungen durch.
Wenn leichtgradige Symptome vorliegen veranlasst er eine laborchemische Untersuchung. Dabei wird neben dem Sauerstoffgehalt im Blut auch nach Spaltprodukten von sich auflösenden Blutgerinnseln (D-Dimere) Ausschau gehalten. Ein negatives Testergebnis auf D-Dimere im Blut schließt ein Gerinnsel mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, ein positives Testergebnis erfordert weitere Untersuchungen.
Für die weiteren Untersuchungen eignen sich bildgebende Verfahren, wie die Computertomografie (CT), die Magnetresonanztomografie (MRT) oder auch eine Ultraschalluntersuchung der Beinvenen.
Die aktuelle S2k-Leitlinie von 2023 empfiehlt differenzierte Diagnosepfade: Bei erfahrenem Personal kann eine sofortige ultraschallgestützte Diagnostik erfolgen, bei weniger erfahrenen erfolgt zunächst eine Bewertung der klinischen Vortestwahrscheinlichkeit, dann ein D-Dimer-Test, gefolgt von bildgebender Diagnostik.
Instabile Patienten mit starken Symptomen oder verhärtetem Verdacht auf eine Lungenembolie werden vom Arzt oder von der Ärztin mit einer Echokardiografie untersucht. Diese Art der Ultraschalldiagnostik dient der Beurteilung der Herzleistung sowie der Druckbelastung des Herzens. Außerdem lassen sich mittels dieser Methode verschiedene Herzerkrankungen diagnostizieren und voneinander unterscheiden.
Wie wird eine Lungenembolie behandelt?
Der behandelnde Arzt oder behandelnde Ärztin wählt die Behandlung nach der Schwere der Lungenembolie und verschiedenen Risikofaktoren aus. Das wichtigste Behandlungsziel stellt die Öffnung der verschlossenen Lungengefäße dar, um eine erneute Embolie zu verhindern.
Erleidet der Patient oder die Patientin einen Herz-Kreislauf-Stillstand, leitet der Arzt oder die Ärztin sofort wiederbelebende Maßnahmen ein. Die Patienten werden häufig zusätzlich künstlich beatmet, um Folgeschäden an den Organen zu vermeiden.
Bei Patienten mit einem stabilen Kreislauf wird zunächst auf eine halbsitzende und ruhige Haltung geachtet. Außerdem kommen häufig Medikamente für eine Verdünnung und langsamere Gerinnung des Blutes (Antikoagulanzien) zum Einsatz. Wenn nötig, erhalten Patienten Sauerstoff über eine Maske. Diese Maßnahmen setzt der Arzt oder die Ärztin vor allem zur Behandlung einer Lungenembolie ohne akute Lebensgefahr ein. Heutzutage kommen bevorzugt direkte orale Antikoagulanzien (DOAK) wie Apixaban oder Rivaroxaban zum Einsatz. In schweren Fällen verabreicht der Arzt oder die Ärztin Medikamente, die das Blutgerinnsel in den Gefäßen gezielt auflösen. Bei dieser Lyse-Therapie besteht jedoch ein hohes Risiko für Blutungen in anderen Organen. Auch werden oft Schmerzmittel und angstlösende Präparate eingesetzt, um den Patienten zu beruhigen und ihm die Schmerzen zu nehmen.
Für manche Patienten ist eine Behandlung mit Antikoagulanzien nicht möglich, vor allem wenn diese ein erhöhtes Blutungsrisiko besitzen. Um das verengte Blutgefäß zu öffnen, verwendet der Arzt oder die Ärztin dann oftmals ein Katheter. Dieser wird in das betroffene Gefäß eingeführt und kann dort das Blutgerinnsel zerkleinern. Zusätzlich können Lyse-Medikamente durch den Katheter verabreicht werden, um das Blutgerinnsel in den Gefäßen aufzulösen.
Bleibt diese Methode erfolglos, nimmt der Arzt oder die Ärztin einen operativen Eingriff unter Vollnarkose vor. Da dieser Eingriff riskant ist, wird er nur als letzte Möglichkeit der Behandlung eingesetzt. Diese Patienten werden im Anschluss auf einer Überwachungsstation im Krankenhaus oder auf einer Intensivstation versorgt.
Oftmals erfolgt nach der Sofortbehandlung einer Lungenembolie eine Therapie mit Blut-verdünnenden Medikamenten (Erhaltungstherapie) für drei bis sechs Monate. Besteht danach weiterhin ein hohes Embolie-Risiko, kann eine dauerhafte Einnahme notwendig werden. Außerdem ist es wichtig, dass der Patient am Ende der Erhaltungstherapie zu weiteren Nachsorgeuntersuchungen erscheint. Hier überprüft der Arzt oder die Ärztin die Atmung und die funktionelle Einschränkung der Lunge. Zusätzlich zur medikamentösen Nachsorge gehören das Tragen von Kompressionsstrümpfen, regelmäßige Bewegung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Gewichtsabnahme (wenn Übergewicht vorliegt).
Was können Sie selbst bei einer Lungenembolie tun?
Liegt der Verdacht einer Lungenembolie vor, sollten Betroffene oder Menschen in ihrer Nähe schnell handeln und den Notruf rufen. Die Wahrscheinlichkeit in den ersten zwei Stunden nach Symptombeginn an einer Lungenembolie zu sterben ist besonders hoch.
Nach einer überstandenen Erkrankung besteht oftmals ein erhöhtes Risiko für eine erneute Lungenembolie. Daher ist es ratsam, die Medikamenteneinnahme nicht frühzeitig abzubrechen. Für manche Patienten ist eine lebenslange Einnahme der blutverdünnenden Medikamente notwendig. Außerdem ist es empfehlenswert weitere Risikofaktoren wie Rauchen und Übergewicht zu vermeiden.
Bettlägerige oder ältere Menschen, Patienten nach Operationen sowie Personen nach langen Flugreisen sollten außerdem auf ausreichend Bewegung und Flüssigkeitszufuhr achten. Um den Blutfluss in den Gefäßen anzuregen, ist auch der Einsatz von Kompressionsstrümpfen möglich.
Veröffentlicht am: 16.03.2023
Letzte Aktualisierung: 23.27.2025
____________________________________________________________________________________________________________________________
ICD Code(s)
ICD Codes sind Internationale statistische Klassifikationen der Krankheiten zu finden z.B. auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Ärztebriefen. Die Zuordnung basiert auf dem Diagnoseschlüssel ICD-10 BMSGPK 2022 (März 2022)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Quellen
[1]: Pschyrembel Klinisches Wörterbuch online. Lungenembolie (Stand 04.2020). https://www.pschyrembel.de/Lungenembolie/K0DC4
[2]: Amboss. Lungenembolie (18.12.2021). https://www.amboss.com/de/wissen/Lungenembolie/
[3]: Anästhesie und Intensivmedizin für die Fachpflege, 10. Auflage. Lungenembolie und akutes Cor pulmonale (14.06.2016). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7531529/
[4]: Gelbe Liste Pharmaindex. Lungenembolie (31.05.2019). https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/lungenembolie
[5] National Library of Medicine Prevalence of Venous Thromboembolism in Critically Ill COVID-19 Patients: Systematic Review and Meta-Analysis https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7874113/
[6] Springer Nature Link Venous Thromboembolism and COVID-19—an Epidemiological Perspective https://link.springer.com/article/10.1007/s12262-022-03423-2
Unsere Qualitätssicherung

„Es ist mir ein großes Anliegen, Menschen dabei zu helfen, ein gesundes und möglichst sorgenfreies Leben zu führen. Mithilfe unserer Ratgeber haben wir die Möglichkeit, unser Apotheker-Wissen schnell und einfach weiterzugeben.“
Als gelernte approbierte Pharmazeutin hat Kathrin Rund schon in diversen leitenden Funktionen gearbeitet und unterstützt unsere SHOP APOTHEKE aktuell als Associate Director im Bereich Pharma Process. Mit ihrer langjährigen Expertise steht sie hinter unseren Ratgebern, die umfassend über verschiedene Gesundheitsthemen informieren.