Leistenbruch - Ursachen, Symptome und Behandlung
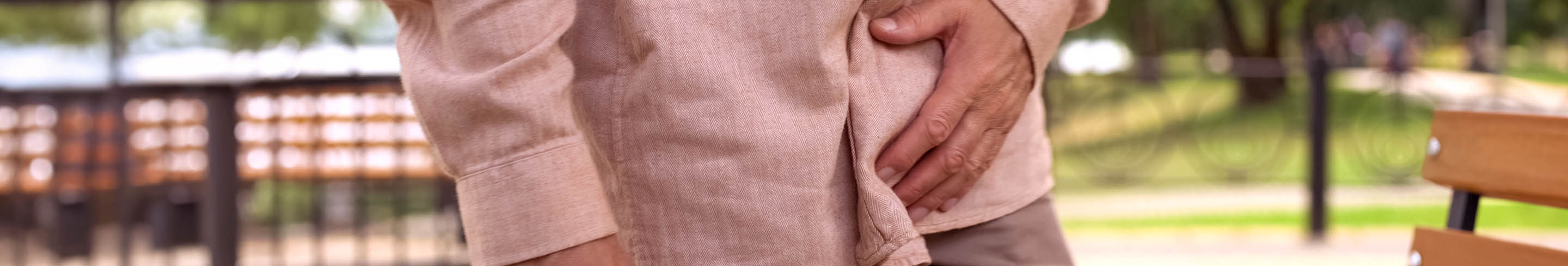
Schnelleinstieg in unsere Themen
Ein Leistenbruch (Leistenhernie) entsteht, wenn der Leistenkanal (Canalis inguinalis) eine Schwachstelle hat und daraufhin Bauchfell und Organabschnitte – wie ein Teil des Darms – aus der Bauchhöhle austreten können. Die betroffene Stelle der Leiste schwillt an, wodurch es unter Umständen zu Schmerzen kommt. Bei starken Schmerzen oder wenn der Darm eingeklemmt wird, ist eine operative Behandlung notwendig. Die verwendete Operationstechnik wird individuell gewählt. Meistens sind Männer betroffen, da ihr Leistenkanal anfälliger ist.
Was ist ein Leistenbruch?
Ein Leistenbruch (Leistenhernie) liegt dann vor, wenn die Wand des Leistenkanals nachgibt und sich Bauchinhalt, meist Fettgewebe oder ein Darmanteil, nach außen vorwölbt. Bei dem Leistenkanal handelt es sich um eine wenige Zentimeter lange und röhrenförmige Verbindung zwischen Bauchhöhle und äußerer Genitalregion. Er zieht sich durch eine muskelfreie Stelle in der Bauchwand und beinhaltet beim Mann den Samenstrang und bei der Frau das sogenannte Ligamentum teres uteri, ein Halteband der Gebärmutter (Uterus) zu den großen Schamlippen.
Das Bauchfell (Peritoneum) kleidet normalerweise die Bauchhöhle aus, in der die Organe eingebettet sind. Bei einem Leistenbruch wölbt sich das Bauchfell nach außen und bildet den sogenannten Bruchsack. Der Bruchinhalt sind meist Fett und Darmgewebe, tritt durch die Bruchpforte, also die eigentliche Schwachstelle der Bauchwand. Deswegen kommt es zu einer sicht- und tastbaren Schwellung in der betroffenen Leistengegend.
Meistens sind Männer von einem Leistenbruch betroffen. Etwa jeder vierte Mann hat einmal in seinem Leben einen Leistenbruch, während Frauen eine Häufigkeit von zwei Prozent aufweisen. Der Grund liegt in der anatomischen Struktur des männlichen Leistenkanals, der größer und durch den Durchtritt des Samenstrangs anfälliger für Hernien ist.
Was sind die Symptome eines Leistenbruchs?
Ein Leistenbruch wird sichtbar durch eine Schwellung in der Leistengegend. Prinzipiell wird zwischen einem symptomatischen und einem asymptomatischen Leistenbruch unterschieden. Asymptomatisch heißt, dass keine Beschwerden wahrgenommen werden. Dagegen bedeutet symptomatisch, dass die betroffene Stelle der Leiste schmerzt.
Treten zusätzlich Symptome wie Fieber und Übelkeit auf, ist umgehend ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, da dies möglicherweise ein Hinweis dafür ist, dass ein Teil des Darms eingeklemmt ist und nicht ausreichend durchblutet wird. In seltenen Fällen kommt es zu einem Darmverschluss. In solchen Fällen ist eine Notoperation notwendig.
Wie entsteht ein Leistenbruch?

Wenn der Leistenkanal eine Schwachstelle aufweist, steigt die Wahrscheinlichkeit, einen Leistenbruch zu entwickeln. Dann ist es möglich, dass der Bereich der Schwachstelle den Druck aus der Bauchhöhle nicht mehr standhält. Gibt die Bauchwand nach, bildet sich ein Bruchsack, und Darm- sowie Fettgewebe wölben sich nach außen in die Leistengegend.
Mögliche Risikofaktoren, die die Entstehung eines Leistenbruchs unter Umständen begünstigen, sind:
- Männliches Geschlecht
- Familiäre Veranlagung
- Früherer Leistenbruch
- Alter (Ab einem Alter von ca. 65 Jahren, sind Männer besonders gefährdet)
- Chronischer Husten (z.B. durch Rauchen oder Lungenerkrankungen)
- Schwaches Bindegewebe (z.B. durch genetische Faktoren oder Erkrankungen wie das Marfan-Syndrom
- Übergewicht
- Schwere körperliche Belastung oder häufiges schweres Heben
- Chronische Verstopfung mit starkem Pressen beim Stuhlgang
Diese Faktoren erhöhen entweder den intraabdominalen Druck oder beeinträchtigen die Stabilität der Bauchwand, wodurch die Entstehung eines Leistenbruchs wahrscheinlicher wird.
Wie wird ein Leistenbruch diagnostiziert?
Die Diagnose Leistenbruch lässt sich in den meisten Fällen durch eine körperliche Untersuchung einfach und eindeutig feststellen. Selten bedarf es einer Ultraschall-Untersuchung oder einem Scan des Leistenbereichs durch MRT- oder CT-Geräte. Trotzdem wird der Arzt oder die Ärztin zu Beginn immer eine Anamnese (Befragung) durchführen, in der er Erkrankungen anderer Familienmitglieder, weitere Erkrankungen des Patienten und akute Beschwerden abfragt.
In Zweifelsfällen oder wenn der Bruch nicht eindeutig tastbar ist (z. B. bei adipösen Patienten oder bei unklaren Schmerzen), können bildgebende Verfahren wie Ultraschall eingesetzt werden. Moderne bildgebende Verfahren wie CT-Scans oder MRT-Scans werden eher selten verwendet, sind aber insbesondere hilfreich, wenn Komplikationen wie eine Einklemmung oder ein Darmverschluss vermutet werden oder wenn der Befund unklar ist.
Die Bildgebung unterstützt zudem die Planung der Behandlung, vor allem vor komplexeren oder Rezidivhernien.
Wie wird ein Leistenbruch behandelt?
Die Art der Behandlung richtet sich nach den Symptomen. Nicht schmerzhafte Leistenbrüche werden in der Regel nicht behandelt, sondern vorerst beobachtet („waitful watching“). Gegebenenfalls wird ein Bruchband (eine Bandage) verordnet, wenn Betroffene z.B. schwer heben müssen, damit das geschädigte Gewebe mehr Halt hat. Verändert sich der Gesundheitszustand, sodass sich zum Beispiel der Bruchsack vergrößert und treten weitere Symptome auf, wird eine Behandlung in Betracht gezogen.
Schmerzhafte Leistenbrüche werden meistens operativ behandelt. Außerdem wird immer operiert, wenn Verdacht auf einen Darmverschluss besteht oder der Darm mehrfach durch die Bruchstelle rutscht. Die Operation ist die einzige Therapieform für einen Leistenbruch. Jedoch gibt es verschiedene Operationstechniken, die individuell gewählt werden.
-
1. Offene Operation
- Bei einer offenen Operation wird der Leistenbruch über einen längeren Schnitt in die Haut von außen behandelt. Der Bruchinhalt wird zurück in die Bauchhöhle verlegt und der Leistenkanal wieder geschlossen.
- Die Bruchpforte wird entweder mit körpereigenem Bindegewebe oder einem Kunststoffnetz überdeckt und vernäht.
- Für einen schmerzfreien Eingriff ist bei dieser Technik auch eine lokale Betäubung möglich. Erst ab einem Alter von 65 empfiehlt sich eine Vollnarkose, um das Komplikationsrisiko zu verringern.
-
2. Minimalinvasive Operation (auch laparoskopische Operation genannt)
- Bei dieser Art der Operation werden nur kleine Hautschnitte gemacht, über die sich eine Kamera und OP-Utensilien einführen lassen. Der Leistenbruch wird dann unter der Haut gerichtet und vernäht.
- Während der minimalinvasiven Operationstechnik verwenden Ärzte immer ein Kunststoffnetz, um den Leistenkanal zu schließen.
- Neuere Studien zeigen, dass offene Operationen bei Frauen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu chronischen Schmerzen und Schenkelhernien führen können, weshalb hier oft minimalinvasive Verfahren bevorzugt werden.
- Betroffene erholen sich bei der minimalinvasiven Methode meist schneller, haben geringere postoperative Schmerzen und können zügiger in den Alltag zurückkehren. Allerdings ist diese Technik anspruchsvoller für den Operateur und erfordert spezialisierte Kliniken.
Eine Leistenbruch-Operation ist eine der häufigsten chirurgischen Eingriffe. In der Regel dürfen die Patienten nach zwei Tagen stationären Aufenthalts wieder nach Hause. Manchmal sind auch ambulante Eingriffe möglich. Etwa drei bis fünf Tage nach der Operation sind leichte Aktivitäten und der gewohnte Alltag meistens wieder möglich.
Allerdings ist es wichtig, einige Tage husten, pressen und schweres Heben möglichst zu vermeiden, da durch den dabei ausgeübten Druck die Naht und der Leistenkanal unter Umständen reißen kann.
Obwohl eine Operation immer Risiken mit sich bringt, verläuft die Operation bei einem Leistenbruch in den meisten Fällen komplikationslos. In seltenen Fällen kommt es zu Schäden an Nerven oder am Samenstrang, die durch den Leistenkanal verlaufen.
Viele Patienten haben direkt nach der Operation Schmerzen an der Eingriffsstelle, doch diese ebben nach wenigen Tagen ab. Dennoch ist es möglich, dass nach der Operation chronische Schmerzen auftreten. Diese unerwünschte Wirkung wird als CPIP (chronische postoperative inguinale Schmerzen) bezeichnet, wenn sie länger als drei Monate andauern. Oft werden dagegen Medikamente zur Schmerzlinderung verschrieben. Neue Studien zeigen zudem, dass sanfte Operationstechniken und eine auf den Patienten abgestimmte Schmerzbehandlung helfen können, chronische Schmerzen nach der Operation zu verhindern.
Nach der Operation besteht weiterhin die Möglichkeit eines Rezidivs, also einen zweiten Leistenbruch zu entwickeln. Wenn das passiert, wird wieder je nach Schmerzempfinden operiert. Die Narben, die sich an den Operationsstellen gebildet haben, verhindern jedoch meistens wieder die gleiche Operationstechnik anzuwenden. Deswegen wird bei der zweiten Operation in der Regel jeweils die andere Technik genutzt.
Frauen werden in den meisten Fällen nicht offen operiert, da auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit, dass sich chronische Schmerzen entwickeln, gesenkt wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Frauen durch eine offene Operation eine Schenkelhernie bilden.
Zudem ist es ratsam, schwangere Frauen mit Verdacht auf Leistenbruch zunächst zu beobachten, da die Schwellung oft nicht wirklich ein Leistenbruch, sondern eine Vorwölbung des Mutterbandes ist.
Was können Sie selbst bei einem Leistenbruch tun?
Einem Leistenbruch kann nicht durch Eigeninitiative entgegengewirkt werden. Wenn starke Schmerzen auftreten, ist nur eine Operation hilfreich. Wenn Sie eine familiäre Veranlagung haben, ist es empfehlenswert, weitere Risikofaktoren möglichst gering zu halten. Wenn Übergewicht vorliegt ist es sinnvoll zu versuchen, Gewicht zu reduzieren – damit sinkt das Risiko für einen Leistenbruch und es trägt zu einem insgesamt gesünderen Lebensstil bei. Schieben Sie einen durch den Bruch gerutschten Darm nicht zurück, sondern wenden sie sich dann an einen Arzt oder Ärztin. Der Darm könnte sonst abgeklemmt werden.
In den ersten Tagen und Wochen nach einer Leistenbruch-Operation ist es wichtig, das zu tun, was sich für Sie gut anfühlt. Versuchen Sie, nicht zu schnell Ihren gewohnten Aktivitäten nachzugehen. Vor allem husten, pressen und schweres Heben ist zu vermeiden, damit der Leistenbruch und die Nähte gut abheilen.
Veröffentlicht am: 27.09.2023
Letzte Aktualisierung: 31.07.2025
____________________________________________________________________________________________________________________________
ICD Code
____________________________________________________________________________________________________________________________
ICD Codes sind Internationale statistische Klassifikationen der Krankheiten zu finden z.B. auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Ärztebriefen. Die Zuordnung basiert auf dem Diagnoseschlüssel ICD-10 BMSGPK 2022 (März 2022)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Quellen
[1]: Gesundheitsinformation. Leistenbruch bei Männern (Stand 14.01.2020)
https://www.gesundheitsinformation.de/leistenbruch-bei-maennern.html
[2]: Gesundbund. Hernien (Stand 03.07.2025)
https://gesund.bund.de/hernien
[3] Annals of Surgery Open Preperitoneal Inguinal Hernia Repair, TREPP Versus TIPP in a Randomized Clinical Trial https://journals.lww.com/annalsofsurgery/fulltext/2021/11000/open_preperitoneal_inguinal_hernia_repair%2C_trepp.4.aspx
[4] PLOSone Nationwide Prevalence of Groin Hernia Repair https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054367
[5] van den Heuvel, B., & Dwars, B. J. (2014). Chirurgie (7. Auflage). Thieme Verlag.
Unsere Qualitätssicherung

„Innovation und Veränderung voranzutreiben und dadurch das Leben der Menschen besser zu machen, ist für mich ein großes Anliegen. Die Gesundheit unserer Kunden liegt mir sehr am Herzen, daher stehe ich mit meinem Team hinter dem Ratgeber.“
Als pharmazeutische Teamleitung innerhalb der pharmazeutischen Beratung unterstützt Sarah Handrischeck unser Unternehmen und unsere Kunden bei Fragen diverser Gesundheitsthemen. Die Ratgeber der SHOP APOTHEKE machen es möglich, kompaktes Apotheker-Wissen zu vermitteln und über wichtige Gesundheitsthemen aufzuklären.




